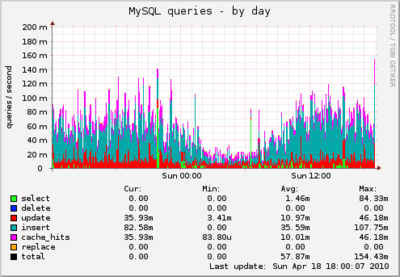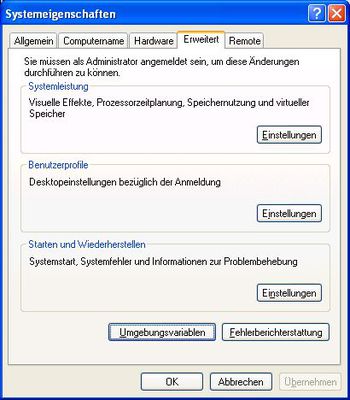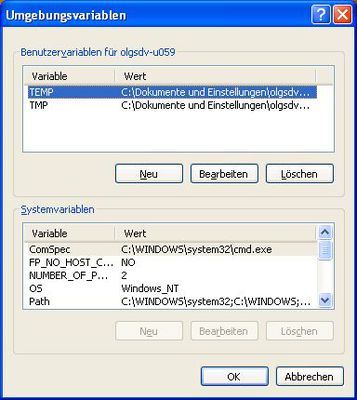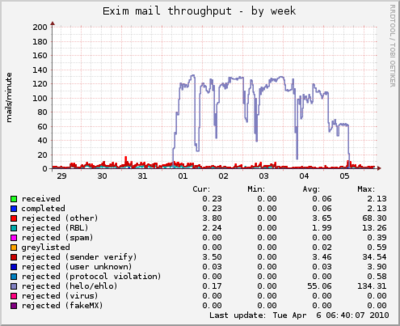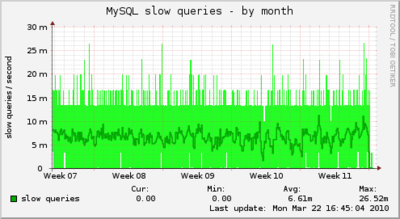Szlaues Szaf, smartes phone
Vergangenes Wochenende hatte ich von der diesjährigen Mitgliederversammlung von bawue.net berichtet und dabei auch meiner Hoffnung Ausdruck gegeben, vielleicht die eine oder andere dort aufgeschnappte - teils schon ältere - Idee doch bald einmal ausprobieren zu können. Heimlich gehofft hatte ich dabei auf einen Test eines VPN von meinem Laptop aus - soweit bin ich allerdings (noch) nicht. Jedoch hatte ich dort gefühlt bei jedem zweiten Teilnehmer ein Smartphone gesehen und die Gelegenheit genutzt, mich einmal zu erkundigen, was die Dinger denn so können und wofür man sie wirklich benutzen kann. Schließlich frage ich mich schon länger, ob es sich für mich wohl lohnen würde, doch vergleichsweise viel Geld in die Hand zu nehmen, um ein iPhone, Samsung, Nexus oder was auch immer zu erwerben. Die Antworten waren vielfältig (E-Mails lesen, Reise-/Routenplaner, SSH-Client, Tethering für den Laptop; auch ein tolles Spiel, bei dem man Flugzeuge koordiniert auf Landebahnen befördern muß, wurde als "Killerapplikation" genannt), so recht überzeugt war ich von dem wirklichen Nutzen aber noch nicht. Immerhin trage ich meist auch meinen Laptop mit mir herum, habe dafür inzwischen eine brauchbare UMTS-Karte gefunden, und wer weiß, was man auf einem so kleinen Bildschirm und ggf. ohne echte Tastatur sinnvoll tun kann?
Nun kam aber inzwischen dazu, daß ich mir auch Twitter mal angesehen habe, und der channelansässige Hardwareproll ![]() mir bedeutete, Twittern ohne "mobile device" sei auf Dauer nicht so richtig zielführend. Überdies war ich letztes Wochenende - und den Großteil der Woche - krank und dementsprechend als empfindliches männliches
mir bedeutete, Twittern ohne "mobile device" sei auf Dauer nicht so richtig zielführend. Überdies war ich letztes Wochenende - und den Großteil der Woche - krank und dementsprechend als empfindliches männliches Wesen Szaf natürlich sehr trostbedürftig. Also habe ich - nach Einholung einiger Informationen zu Modellen und Tarifen - einfach mal eine größere Menge Geld in die Hand genommen und mir ein HTC Desire zugelegt. Zurückschicken kann man es ja immer noch, nicht wahr?
Und mittlerweile muß ich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich bisher ohne ausgekommen bin. ![]()
Ich telefoniere zwar immer noch mit meinem bisherigen, nunmehr schon etliche Jahre alten Modell, aber es ist einfach toll, auch unterwegs mal eben nach neuen E-Mails schauen zu können, Kalender und Kontakte dabei zu haben und synchronisieren zu können, zu twittern oder schnell mal was im Web nachzusehen, sich dank GPS und GoogleMaps jederzeit orientieren zu können, und was der Dinge mehr sind. Natürlich habe ich auch ein paar Spiele getestet - und die Geschichte mit den Flugzeuglandungen hat definitiv Suchtcharakter. ![]() Auch die Akku-Laufzeit ist - wenn man mit der Nutzung ein bißchen sparsam ist und GPS und WiFi ausschaltet, solange man es nicht braucht bzw. unterwegs ist - mit "problemlos ein Arbeitstag" durchaus im brauchbaren Bereich.
Auch die Akku-Laufzeit ist - wenn man mit der Nutzung ein bißchen sparsam ist und GPS und WiFi ausschaltet, solange man es nicht braucht bzw. unterwegs ist - mit "problemlos ein Arbeitstag" durchaus im brauchbaren Bereich.
Insofern lautet mein vorläufiges Fazit nach weniger als einer Woche: Das hätte ich mir schon früher gönnen sollen!